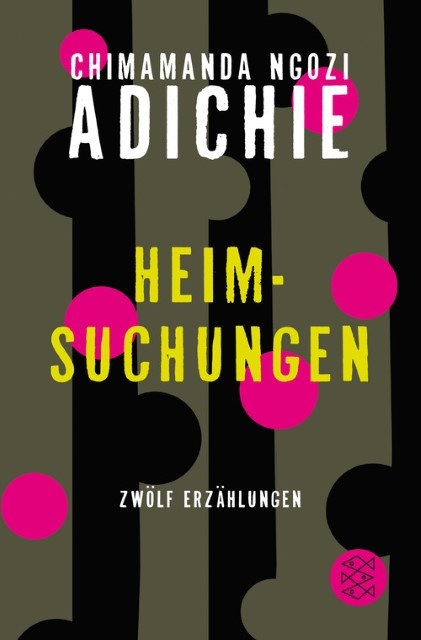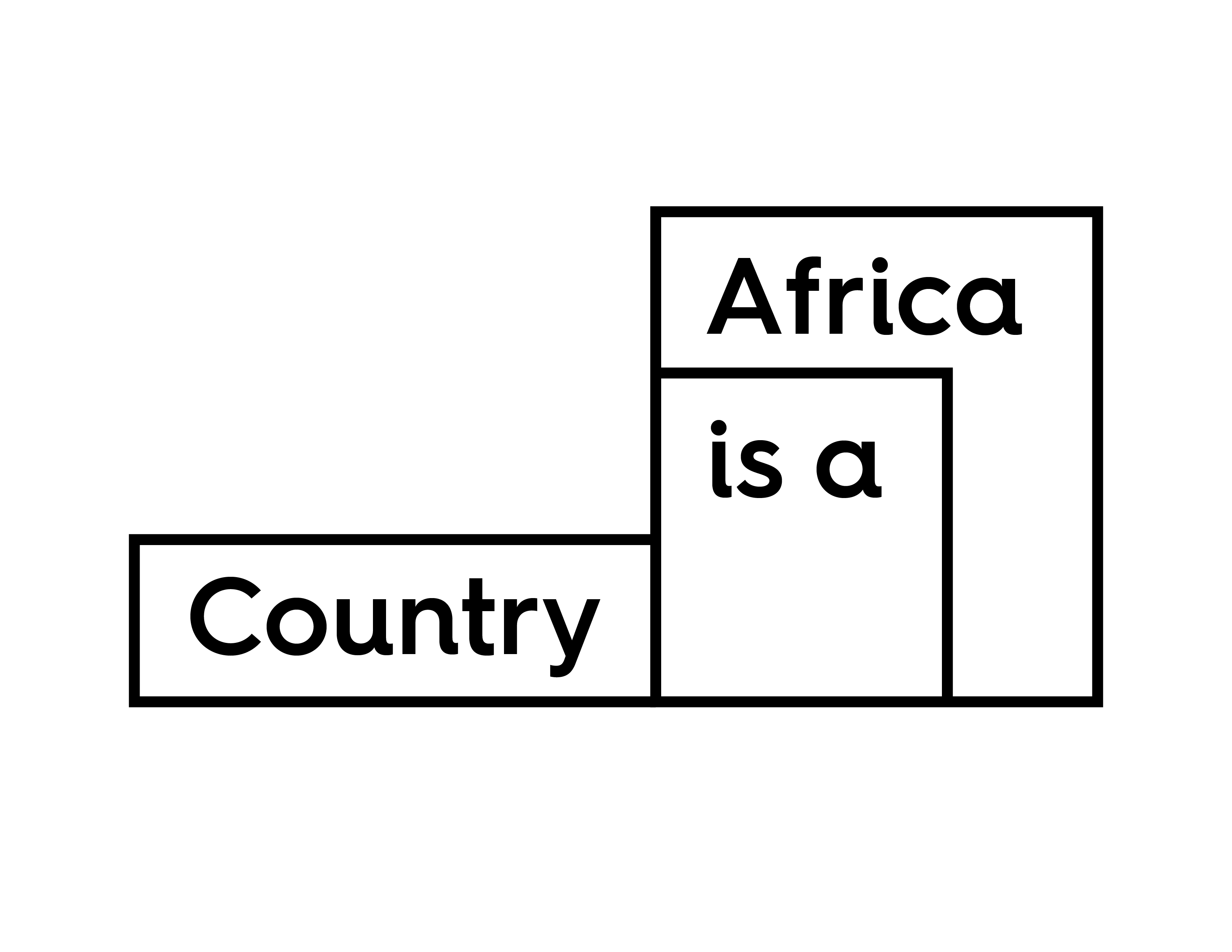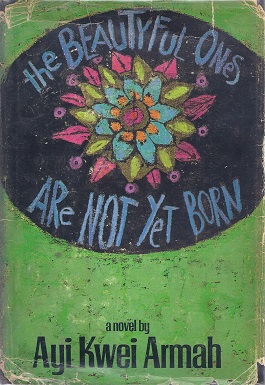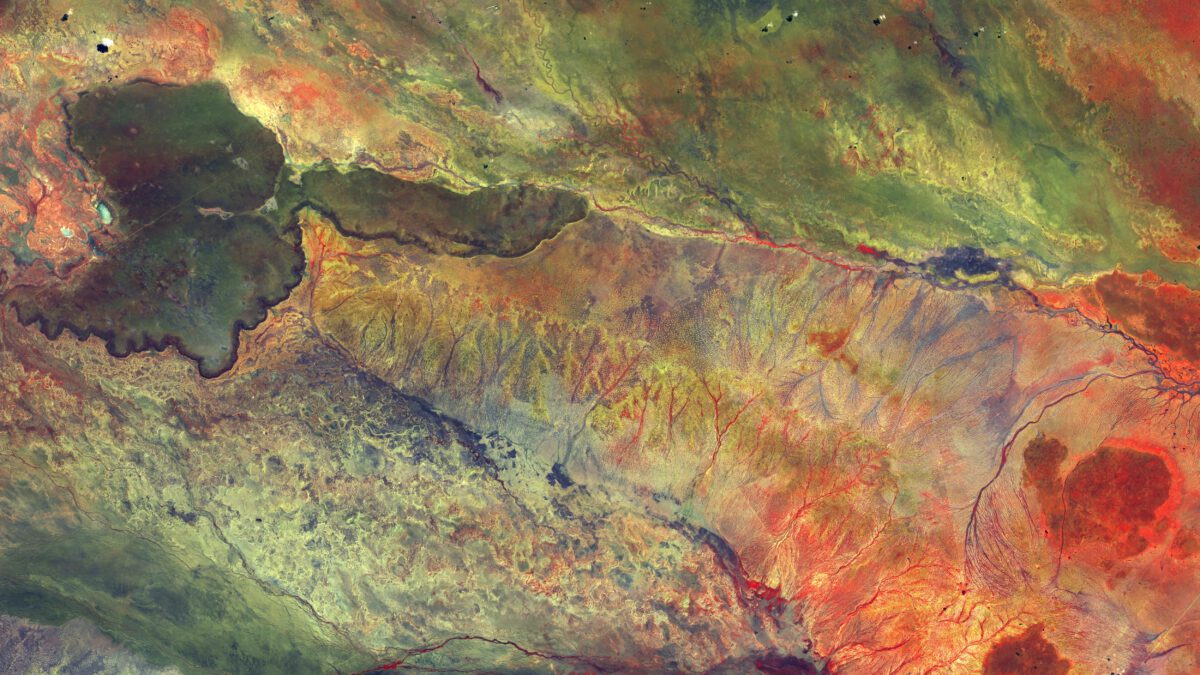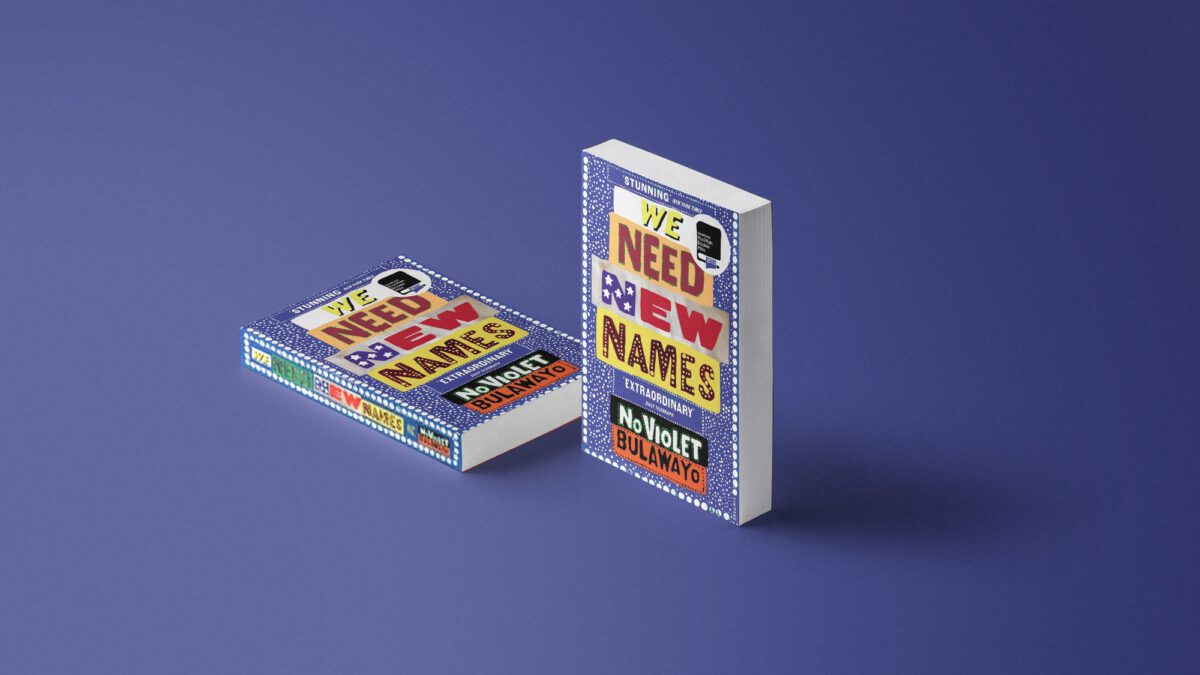Verschenken oder selber Schmökern?
Für das Buchfest Weihnachten ist dieses Jahr einiges anders: das Coronajahr belastet nicht nur die Buchbranche, sondern wirft uns Leserinnen und Leser immer wieder auf uns selbst und in unsere eigenen vier Wände zurück. Nicht verzagen, denn glücklicherweise gibt es da ein Heilmittel: den Bücherkauf! Egal, ob ihr noch einen Roman zum Verschenken sucht oder euch selbst mit einer guten Lektüre verwöhnen wollt – es gibt mit Sicherheit das eine oder andere Werk von afrikanischen Autor:innen, das ihr noch nicht kennt. Hier empfehlen wir euch fünf tolle Bücher für die Festtagslektüre.
1. Wo wir stolpern und wo wir fallen
Abubakar Adam Ibrahim
Residenz Verlag
360 Seiten
Für den Drogendealer Reza ist der Einbruch in das Vorstadthäuschen der Witwe Binta Zubairu bloß die Routine eines heißen Vormittags. Einen Herzschlag später wissen beide: Das, was hier geschieht, dürfte nicht sein. Die Anziehungskraft, die sie erfasst, das Begehren, das ihnen selbst ein Rätsel bleibt, verstößt gegen alle Regeln der traditionellen muslimischen Gesellschaft der Stadt Jos. Und doch: Vor dem Hintergrund der politischen und religiösen Gewalt in Nigeria entfaltet sich die sinnliche, kämpferische und verzweifelt unmögliche Liebesgeschichte zwischen einer alternden Frau, die ihren Sohn verloren hat, und dem um 30 Jahre jüngeren Anführer der Gang des Viertels. Ein üppig erzählter Roman, das lebendige Porträt einer zwischen Tradition und Moderne zerrissenen Gesellschaft.
Diese Geschichte über eine Amour fou ist nicht zuletzt dadurch so besonders, dass Ibrahim mit einem gesellschaftlichen Tabu bricht. Über Sexualität einer muslimischen Frau zu schreiben, ist in den Literaturen Afrikas, insbesondere in muslimisch geprägten Ländern, selten.
Ibrahims Roman ist zugleich ein Abbild der nigerianischen Gesellschaft. Zwei Welten prallen aufeinander: die im Islam verankerte Tradition eines Patriachats mit Polygamie und die afrikanische Moderne mit Smartphone, Telenovela, Sex, Drogen und Kriminalität. Für Letztere steht Reza, ein so skrupelloser wie sympathischer Gangleader, der mit Haschisch dealt, Polizisten besticht, geheime Aufträge für einen korrupten und machtgierigen Senator übernimmt.
Überschrieben hat Ibrahim die einzelnen Kapitel mit amüsanten nigerianischen Sprichwörtern: „Wer einen alten Mann verspeist, darf sich nicht beschweren, wenn er anschließend graue Haare spuckt.“
In kräftigen Farben und zarten Tönen erzählt Ibrahim von dieser schönen, verbotenen Liebe.
2. First Woman
Jennifer Nansubuga Makumbi
Oneworld Publications
448 Seiten, englisch
Kirabo ist ein wissbegieriges Kind. Sie hat noch mehr unbeantwortete Fragen als andere Mädchen in der Pubertät, von denen die größte und geheimnisvollste ist: „Wer ist meine Mutter?“ In dem kleinen ugandischen Dorf Nattetta scheint ihr das niemand sagen zu wollen, am wenigsten die Großeltern, die sie ihr Leben lang geliebt und beschützt haben. Auch die flüchtigen Besuche ihres Vaters Tom, der in Kampala sein Unwesen treibt, bringen keine weiteren Erkenntnisse. So beschließt Kirabo, bereits tief verunsichert durch ihre Fähigkeit, ihren Körper zu verlassen und über ihre Nachbarschaft zu schweben, die Dorfhexe Nsuuta zu konsultieren.
Kirabo ist von starken Frauen umgeben. Ihre Großmutter, Tanten, Freund:innen und Cousins und Cousinen wollen alle, dass sie sich an die sozialen Normen anpasst, aber Kirabo ist neugierig, eigensinnig und entschlossen. The First Woman folgt Kirabo auf ihrem Weg, eine junge Frau zu werden und ihren Platz in der Welt zu finden, während ihr Land durch die Herrschaft von Idi Amin verändert wird.
Jennifer Makumbi hat eine mitreißende Geschichte von Sehnsucht und Rebellion geschrieben, zugleich episch und zutiefst persönlich, durchdrungen von einer berauschenden Mischung aus alter ugandischer Folklore und modernem Feminismus. Eine Lektüre, die nachklingt.
3. The Shadow-King
Maaza Mengiste
Canongate Books
428 Seiten
The Shadow-King stand dieses Jahr auf der Shortlist für den Booker Preis, existiert aber leider noch nicht auf deutsch. Die Geschichte spielt im Kontext des italienischen Einmarsches in Äthiopien in den 1930er Jahren, hat also einen historischen Hintergrund, von dem man hierzulande noch nicht allzu viel weiß.
Mengiste erzählt hier die Geschichte von Hirut, einem verwaisten jungen Mädchen, das von denen, die sich um sie kümmern sollten, im Stich gelassen wurde. Hirut wird von dem Freund ihrer Mutter, Kidane, aufgenommen und ist eine Dienerin in seinem Haushalt, wo sie von den unberechenbaren Eifersüchteleien und Launen seiner Frau Aster gequält wird.
Aber ihr Leben wird nicht dasselbe sein, das Generationen vor ihr gelebt haben. Der Krieg steht vor der Tür, und Hirut beobachtet, wie Kidane Waffen sammelt und eine lokale Miliz aufbaut, um der italienischen Invasion zu begegnen. Mengiste folgt diesen Ereignissen, während die Italiener immer näher an ihre Gemeinde herankommen und sich zuhause die Spannungen zwischen Aster und Kidane verschärfen. Mit der Zeit spielen sie alle eine Rolle, wobei Aster eine überraschende Führungsrolle übernimmt und Hirut sich als geschickte Kämpferin erweist. Die Miliz, mit Frauen und Kindern in unterstützenden Rollen, bereitet sich auf den Kampf vor, versteckt sich in Höhlen, versucht, den Verwundeten zu helfen und kommt der endgültigen Begegnung mit den Italienern immer näher.
Der Oman ist eine großartig gestaltete und unaufdringliche Erkundung weiblicher Macht, mit Hirut als grimmiger, origineller und brillanter Stimme im Zentrum. Maaza Mengiste haucht den komplizierten Charakteren auf beiden Seiten der Kampflinie Leben ein und formt eine herzzerreißende, unauslöschliche Erkundung dessen, was es bedeutet, eine Frau im Krieg zu sein.
4. Mädchen, Frau, etc.
Bernardine Evaristo
Klett-Cotta Verlag
512 Seiten
Leider erscheint die deutsche Übersetzung erst im Januar 2021, aber die englische Ausgabe ist ja auch im deutschen Buchhandel zu erhalten. Evaristos Roman wurde 2019 mit dem Booker Preis ausgezeichnet. In Girl, Woman, Other werden die Geschichten 12 verschiedener Frauen erzählt, deren Lebenswege sich auf unterschiedlichste Weise kreuzen. Da sind zum Beispiel Amma, eine junge Dramatikerin, deren Werke häufig ihre eigene Identität als schwarze, lesbische Frau thematisieren; Shirley, Ammas gute Freundin, deren Arbeit als Lehrerin an Londoner „Problemschulen“ sie völlig ausgelaugt hat; Carole, eine ehemalige Schülerin von Shirley, aus der eine erfolgreiche Investmentbankerin geworden ist, sowie deren Mutter Bummi, die einst vor der großen Armut in ihrem Heimatland Nigeria floh. Bei allem, was diese Figuren voneinander unterscheidet, gibt es aber doch etwas, das sie miteinander verbindet … Evaristo erzählt humorvoll, warmherzig und schlagfertig von Themen wie Klassenunterschiede, Rassismus, Identität und Frausein. Ein must-read!
5. Das Weinen der Vögel
Chigozie Obioma
Piper Verlag
512 Seiten
Das Chi, also der Schutzgeist des jungen Geflügelbauern Chinonso ruft die Götter an. Hat sein Schützling nicht alles für seine große Liebe Ndali getan? Hat er ihr auf der Brücke nicht das Leben gerettet? War es nicht ihre Familie, die Chinonso, den ungebildeten Farmer, mit Verachtung reizte? Erst diese Verachtung trieb ihn doch nach Zypern, fort von der Heimat, in der Hoffnung auf Bildung, Aufstieg und eine Zukunft mit Ndali. Und wurde nicht erst während dieser Reise Hoffnung zu Wut und Liebe zu Schuld?
Fest in der nigerianischen oralen Tradition verwurzelt, erzählt Chigozie Obioma eine universelle Geschichte, von einem, der sich gegen sein Schicksal stemmt – und gegen die gesellschaftlichen Barrieren, die seiner Liebe im Weg stehen. Das Weinen der Vögel erzählt eine so klug konzipierte und komponierte wie mitreißende und zu Herzen gehende Liebesgeschichte, die einerseits zugleich auch von nigerianischer Zeitgeschichte gesättigt ist, wie sie andererseits die Kultur und die Kosmologie des Volks der Igbo in der Struktur des Romans verankert.
Mit seinem eindrucksstarken und spannungsvollen Roman bekräftigt Chigozie Obioma seinen Ruf als eine der wichtigsten literarischen Stimmen aus der afrikanischen Diaspora.