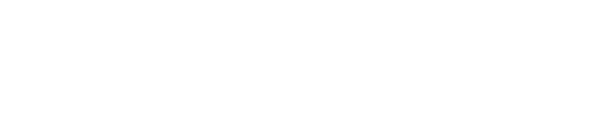Vom imperialen Erbe der Kamera und der erzählerischen Kraft von Wort und Bild.
Mit der Etablierung der Fotografie in den 1830er Jahren übernahmen diejenigen, die diese dunkle Bilderzeugungsmaschine – die Kamera – und ihre Fotos kontrollierten, den imperialen Anspruch auf das Monopol auf Wahrheit und Geschichte. Doch wie die Fotografietheoretikerin Ariella Azoulay darlegt, umfasst das Anfertigen einer Fotografie mehr als nur den Fotografen und die Kamera; vielmehr sind auch die Fotografierten und später die Betrachtenden der Bilder Teil der sozialen Bedeutungen, die durch das Urteil des Auslösers geschmiedet werden.
Diese umfassendere Konzeptualisierung fotografischer Bilder und der Geschichten, in die sie eingebettet sind, entrückt den dominanten Blick der Fotografierenden und schafft Raum für alternative Geschichten, Erinnerungen und Erzählungen.
In diesem Sinne der Verunsicherung der europäischen Konfliktgeschichtsschreibung setzt sich Maaza Mengistes gefeierter zweiter Roman Der Schattenkönig mit dem Zweiten Italo-Äthiopischen Krieg der späten 1930er Jahre auseinander. Anstatt sich nur auf die wichtigsten Ereignisse und Darstellungen des Krieges zu konzentrieren, verlässt Mengiste den traditionellen historischen Rahmen des Schlachtfelds, und entführt die Leser:innen in die persönlichen, ja intimen Lebensbereiche ihrer Figuren, von denen jede einen anderen Blickwinkel auf die Invasion hat. Bei der Entfaltung der Geschichte schöpft sie aus den Schatten der alltäglichen und außergewöhnlichen Kämpfe, die an den Fronten von Klasse, Religion, Geschlecht und Körper im Lichte der Fotografie ausgetragen werden.
Um das Gespenst der Fotografie in Der Schattenkönig zu beleuchten, das sich auf vielfältige Weise mit diesen anderen Themen überschneidet, sprach Mengiste mit Africa is a Country über das imperiale Erbe der Kamera, über Formen des Widerstands gegen den kolonialen Blick, über die Unterschiede in der erzählerischen Kraft von Worten und Bildern und über ihre neue bildorientierte Archivinitiative – Projekt 3541.
ZR: Die Fotografie ist einer der Fäden, die sich durch die Erzählung von "Der Schattenkönig" ziehen. Es gibt eine Figur, die eine Kamera benutzt, aber Anspielungen auf die Geschichte und Philosophie der Fotografie sind in der Geschichte zahlreich und weitreichend. Hatten Sie die Fotografie als ein Schlüsselelement geplant, als Sie mit dem Schreiben begannen, oder hat sich das erst im Laufe der Geschichte ergeben?
MM: Darüber muss ich nachdenken. Diese endgültige Version des veröffentlichten Buches war nicht der Entwurf, den ich ursprünglich geschrieben hatte; den habe ich verworfen. Und in diesem Entwurf war wirklich nichts über Fotografien und Fotografie zu finden. Als ich anfing, über den Italo-Äthiopischen Krieg von 1935-41 und die Beziehungen nachzudenken, die sich im Laufe dieser etwa fünf Jahre in Äthiopien entwickelten, begann ich über den Einsatz der Fotografie als Kriegswaffe durch die Italiener und die meisten Kolonialmächte und imperialistischen Regime zu reflektieren. Ich hatte bereits über Fotografie geschrieben. Fast ein Jahrzehnt lang hatte ich Fotos gesammelt, die Italiener in Äthiopien aufgenommen hatten. Ganz am Anfang wusste ich nicht, was ich da tat. Das war noch bevor ich überhaupt irgendetwas geschrieben habe; ich war keine Schriftstellerin, ich habe mich einfach dafür interessiert. Ich sammelte diese Fotos unbewusst, ich sah sie mir einfach an und dachte: „Oh, die sind schön. Das ist schön, oh, das ist nicht so schön.“
Irgendwann, als ich in Rom recherchierte, interessierte ich mich sehr für die Fotogeschichte dieses Krieges und fing an, fleißiger Fotos zu sammeln, wobei mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, was ich mit ihnen machen wollte. Das half mir, die Geschichte durch andere Augen zu betrachten. Ich betrachtete die persönlichen und intimen Aspekte des Krieges, nicht die großen Schlachten, sondern versuchte, durch diese Fotografien die intimen Verbindungen zu verstehen, die der Krieg Gruppen von Menschen aufzwang. Beim ersten Entwurf besaß ich also schon diese Fotos, und ich habe sie betrachtet, um die Erzählung neu zu schreiben, aber nicht als Geschichte. Aber als ich dann diesen ersten Entwurf loswurde und anfing zu denken: „Ich kann alles machen, was ich möchte“, kehrte ich zu diesen Bildern zurück und begann, sie als ihre eigenen Versionen von Geschichte zu betrachten. Sie sind bewahrte Erinnerungen, aber was genau bewahrten sie und was wollten sie uns zwingen zu übersehen oder zu vergessen? Zusammen mit den Chorstimmen im Buch wurde die Verwendung von Fotografien für mich zu einer weiteren Möglichkeit, unsere Vorstellungen von Geschichte auf den Kopf zu stellen, und das war nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr aufschlussreich. Es hat mir geholfen, Details von Momenten und Personen herauszuarbeiten, die in einer reinen Erzählung nicht möglich gewesen wären.
ZR: Sie haben darüber gesprochen, wie Geschichtsbücher aus bestimmten Perspektiven erzählt werden. Der fotografische Rahmen hat Grenzen, was drin ist, was nicht drin ist, wer die Kamera hält und welche Absichten er verfolgt. Die Narration des Schreibens wird dann zu einem Weg, über den Rahmen hinauszugehen. Können Sie mehr zu diesem Prozess des Hinausgehens sagen?
Ich denke, die Fotos waren wirklich eine Möglichkeit, den Rahmen zu verlassen. Sie zwangen mich auch zu einigen Fragen über die Identität des Fotografen. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Fotos, die gemacht werden – die Kameras sind nicht mehr diese großen, sperrigen Dinger, sie werden mit der Hand gehalten -, nicht von Fotojournalisten oder Profis gemacht werden, sondern von Soldaten, die Italien zum ersten Mal verlassen … Für einige von ihnen ist es ja das erste Mal, dass sie ihre kleine Stadt verlassen! Diese Soldaten waren auf der Suche nach einem Abenteuer in Afrika. Man versprach ihnen einen schnellen, leichten Krieg. Man versprach ihnen Frauen als Trophäen. „Du bekommst das Land, aber du kannst auch die Frauen bekommen.“ Und sie bringen diese Kamera mit. Ich begann darüber nachzudenken, wie sie die Erinnerungen, die sie mitbrachten, gestalten wollten, denn die Fotografien, so offen sie auch waren, waren sehr kalkuliert in Bezug darauf, wer was zu sehen bekam – „wenn ich das nach Hause bringe, zeige ich diese Serie meinen Freunden, diese Serie zeige ich meiner Familie“ – diese Erinnerungen wurden kuratiert. Ich habe angefangen, die Fotografien so zu betrachten. Als Werkzeuge für die Erinnerung, aber auch als Werkzeuge für die Amnesie, für die Auslöschung.
Über diese Leute im Roman zu schreiben hat es mir wirklich ermöglicht, sie auf neue Weise zu betrachten. Ich bin mir bewusst, dass ich eine Figur Ettore habe, und er hat eine Kamera, und ich betrachte die Fotos als Teil eines Gesprächs, das dieser Fotograf mit sich selbst führt. Etwas, das über den Boden hinausgeht, auf dem er steht, und das auch nach Hause zurückreicht. Es ist der Teil von ihm, den er mit nach Hause nehmen will – das, was mit dem Exotischen, dem Erotischen in Verbindung steht. Zurück in der Heimat nimmt der Fotograf etwas von der Exotik der Fotos an. Er wird als etwas angesehen, das sich von den anderen in seiner Stadt unterscheidet, als heroisch und in gewisser Weise genauso unbekannt wie die Menschen, die er auf Film gebannt hat. Diese Fotografien reflektieren wirklich auf den Fotografen zurück, und ich fand, dass dieses Denken bei der Entwicklung der Geschichte hilfreich war. Es half mir, all diese Bilder, die wir für selbstverständlich halten, besser zu verstehen – und ich hielt sie für selbstverständlich, selbst als ich sie sammelte. Wenn man sich aber ein Bild eines stolzen Kriegers mit Schild und Speer anschaut, der einen würdevollen Eindruck macht, dann sieht es überhaupt nicht wie ein negatives oder stereotypes Foto aus. Bis man merkt, dass der Fotograf und der Mann eigentlich Feinde sein müssten. Dann sagt die Tatsache, dass der Fotograf noch am Leben ist, etwas über seine Macht aus und nicht über die Person, die fotografiert wird. Es ist ein Foto der Herrschaft.
ZR: Ihr Buch zeigt, dass ein zentrales Erbe der Kamera eine Technologie des Imperialismus ist. In der Geschichte beschreiben Sie, wie die italienischen Streitkräfte ihre Arbeit als Beweis für die Besatzung und als Rechtfertigung für die Kolonisierung dokumentieren; wie ein Fotograf Momente aufnimmt, festhält und stiehlt, Menschen für ihre Unterwerfung in den Fokus rückt, wie Typografien aus fotografischen Abzügen imaginiert werden. Hat Sie der Prozess des Schreibens dieses Buches angesichts eines solch belastenden Erbes dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob Fotografie unersetzlich ist oder ob sie als kreative Form wertvoll sein kann?
Ich glaube, dass es in der Welt der Fotografie, des Fotojournalismus, einen deutlichen Mangel an Fotograf:innen gibt, die aus den Orten stammen, über die berichtet wird. Wir sehen das ständig, die meisten Fotograf:innen sind weiß, sie sind männlich, junge Fotojournalisten, die sich an Journalistenschulen einschreiben und sich dieses Abenteuer vorstellen; sie sind begeistert von der Gefahr, Fotojournalist zu sein und in ein vom Krieg zerrissenes Land zu gehen. Diese Denkweise ist eine Form des imperialistischen Ehrgeizes. Sie ist kriegsähnlich in ihrem Wunsch zu „erobern“, um das, was fern, unbekannt, exotisch erscheint, bekannt zu machen. Man sieht es auch heute noch.
Kürzlich warb ein bekannter Fotojournalist für einen Fotoworkshop, der in den nächsten Tagen online gehen sollte, aber das Bild, das er verwendete, zeigte eine junge Frau in Indien, die als Sexarbeiterin tätig war. Auf dem Foto liegt ein Mann auf ihr, es ist mitten im Sex, man sieht ihr Gesicht – es ist leer – sie ist ganz woanders und verstört. Und die Kamera blickt auf diese Frau hinunter. Ihr Gesicht ist nicht verdeckt. In diesem Bild ist jeder voyeuristische Aspekt im Spiel. Das ist etwas, das zur Werbung für einen Workshop verwendet wird. Und ich frage mich: Was wird hier beworben? Was geschieht hier? Ich habe dem Fotografen diese Fragen gestellt, und das Bild ist inzwischen entfernt worden. Auf Twitter schrieb jemand namens Ritesh Uttamchandani – ein Fotograf aus Indien -: „Ich bin auch in die Bordelle gegangen, um zu fotografieren, und das hier ist dabei herausgekommen“. Und es war brillant. Er hat vom Bett aus die Decke fotografiert. Man sieht also den Raum, man sieht, wohin das Mädchen schaut, und er sagte, dass er von diesem Standpunkt aus Babyfotos, eine Familie, eine ganze Welt sehen konnte, die sich ihm eröffnete. Man versetzt sich in die Lage der Person, die dort ist. Das bringt mich zum Nachdenken über die Art und Weise, wie heute fotografiert wird, und wie es immer schon war. Die Machtverhältnisse sind verzerrt, und wenn wir nicht in der Lage sind, uns selbst in der Person zu sehen, auf die wir die Kamera richten, wenn wir nicht einen Teil von uns in den Bildern, die wir machen, erkennen oder zu erkennen versuchen, dann projizieren wir die Erfahrungen der Menschen als Faszinationen oder Kuriositäten oder Metaphern oder Lektionen im Leben aufs Bild. Und wir sind immer noch außerhalb.
Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, keine Fotos in das Buch aufzunehmen. Es gibt zwei, die Buchstützen. Das Schreiben des Wort-Bild-Innen-Buches war meine Art, darüber nachzudenken, wie man über das „Zeugnisgeben“ hinauskommt – wobei der Zeuge immer draußen ist und die Last des Zeugnisgebens trägt – und der Akt des Hinsehens eine schwerfällige Verantwortung ist, die der Person auferlegt wird, und es ist keine natürliche Sache, es ist eine Last. Ich frage mich seit langem, wie man das beseitigen kann. Das Foto ist eine Waffe, ein Zeichen von Macht, und es wird immer noch gegen Menschen eingesetzt. Diejenigen, die hinschauen, sind nicht diejenigen, die eine Last tragen. Es sind die Abgebildeten, die das Gleichgewicht der Last halten. Wie können wir das respektvoll anerkennen und uns selbst in jedem Bild, das wir machen, sehen?
Hat Ihre Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie die Fotografie den Menschen verändert, Ihre Art zu fotografieren beeinflusst, insbesondere die von Menschen?
Ich nehme Filme auf und fotografiere auch und ich habe drei oder vier Jahre lang Filmrollen angehäuft. Irgendwann weiß ich nicht mehr, was auf ihnen drauf ist, ich vergesse es. Ich schieße weiter, und von Zeit zu Zeit bekomme ich einen ganzen Haufen Filme und schicke sie zu meinem Entwickler, und dann kommen sie zurück, und es ist immer interessant, weil ich nicht weiß, wo oder wann einige der Filme aufgenommen wurden. Wenn Fotografien eine Form der Auslöschung sind, dann versuche ich vielleicht auch zu verstehen, was dort erhalten bleibt, wenn bestimmte Markierungen nicht mehr existieren. Wenn ich sie betrachte, versuche ich, mein Auge zu verstehen: Was sehe ich da? Was habe ich bei der Aufnahme gesehen? Auf Instagram lade ich hauptsächlich Portäts hoch, denn das ist das, was mich am meisten anzieht. Ich interessiere mich für das Gesicht, und ich interessiere mich dafür, was das Gesicht offenbart. Die Fotografie ist etwas, das mich vom Schreiben ablenkt, von diesem Ort, an dem ich ständig nach Worten suche und noch mehr Worte brauche. Es ist ein guter Weg, um nicht an das Schreiben zu denken, aber ich habe gemerkt, dass ich immer an die Erzählung denke, wenn ich in die Kamera schaue. Es passiert etwas sehr Interessantes, wenn man das Auge hinter dem Sucher hat und fokussiert – es gibt eine andere Welt, die darin zu existieren beginnt, und in dieser Hinsicht ist es dem Schreiben sehr ähnlich. Ich versuche, mein Auge zu entwickeln, denn das ist das gleiche Auge, das ich als Schriftstellerin benutze. Und die Kamera ist mein Werkzeug.

Sie haben davon gesprochen, dass einige der Hauptfiguren aus Archivfotos entstanden sind, auf die Sie bei Ihren Recherchen gestoßen sind. Wie haben sich Ihre Interaktionen mit diesen Archivbildern in Figuren der Geschichte niedergeschlagen? Haben die Fotos zu Ihnen gesprochen?
Ich hatte diese Fotos schon, bevor ich das Buch schrieb, und einige von ihnen hatte ich gerahmt. Während des Schreibens merkte ich, dass sie mir halfen, mir einige meiner Figuren vorzustellen. Irgendwann kramte ich dann in den Fotos italienischer Babys aus den frühen 1900er Jahren, die ich gesammelt hatte. Ich wusste nicht, warum ich vor Jahren nach ihnen gesucht hatte, und ich weiß auch nicht, wer die Babys waren, aber ich hatte Schwierigkeiten, den italienischen Oberst in der Geschichte, Carlo Fucelli, zu entwickeln. Ich beschloss, ihn als Baby zu betrachten. Also hängte ich „sein“ Babyfoto an meinen Schreibtisch und nutzte es, um seine Entwicklung zu dem Mann zu verstehen, der er wurde. Ich beschreibe ein Foto, das Ettore von seinen Eltern am Tag ihrer Hochzeit hat. Ich habe dieses Foto, ich habe ein Foto von einem Paar. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, die Figur Hirut in meinem Kopf zu beschreiben, und ich habe angefangen, meine Fotos durchzusehen, und als ich zu einem bestimmten Foto kam, wusste ich, dass ich es hatte. Ich sagte: Das ist sie. Das Kleid mit dem V-Ausschnitt, das ich beschrieben hatte, die Narbe, die das Kleid verdecken kann, das war auf dem Foto zu sehen, und das ist die Person, die sie ist. Ich habe ein Foto, das Aster sein könnte, ich stellte mir diese Frau in einem Umhang vor, und ich hatte das Foto in meiner Sammlung. Ich hatte die Beschreibung gemacht – wer weiß, ob ich mir diese Fotos nicht schon viel früher angesehen hatte und sie mir im Gedächtnis geblieben waren, aber sie haben mir auf jeden Fall geholfen, mir eine Haltung vorzustellen, nicht ein Aussehen, sondern eine Haltung. Als ich meine italienischen Charaktere schrieb, konnte ich mir diese Soldaten nicht als kleine Jungen vorstellen, sonst wäre es wirklich schwierig gewesen, sie als komplexe menschliche Wesen mit Grausamkeiten und Schwächen zu entwickeln.
Das Buch enthält verschiedene Arten von Zwischenspielen, darunter eine Form namens "Foto", in der "Wortbilder" Bilder beschreiben, ohne dass sie visuell dargestellt werden. Wie haben Sie sich die Funktion dieser fragmentierten Texte vorgestellt? Einige der Passagen sind fast wie kleine fotografische Abzüge geformt und aneinandergereiht.
Die übergreifende Erzählung besteht darin, dass dies angeblich die Fotografien sind, die Hirut sich ansieht, als sie die Kiste in der Geschichte öffnet, und sie ist chronologisch geordnet, sodass jedes Foto, dem man begegnet, zu einem anderen Teil des Krieges und der Geschichte führt. Ich wollte, dass in diesen Bildern Bewegung stattfindet; ich wollte versuchen, mir die Momente davor und danach vorzustellen, was ein Foto für uns oft eliminiert. Es vereinfacht einen Moment. Ich habe mich von einem meiner Lieblingsgemälde inspirieren lassen – Rembrandts „Anatomiestunde“. In diesem Gemälde stehen Medizinstudenten um eine Leiche herum, und in der Mitte steht ein Arzt; alle schauen in verschiedene Richtungen, aber der Arzt zeigt auf etwas und hebt die Hand. Ich habe so lange darauf gestarrt und bin von den Blicken der Studenten zur Leiche, zum Arzt und zu seiner Hand gegangen. Irgendwann wurde mir klar, dass er auf den Muskel der Leiche zeigt, den seine Hand illustriert, und dass er die Bewegung dieses Muskels nachahmt und auf ihn zeigt. Das Gemälde ist also mitten im Geschehen; die Hand des Arztes ist nur ein Zucken des Muskels und eine Bewegung, die vom Maler festgehalten wird. Das ist in Wirklichkeit eine Unterrichtsstunde zum Thema Bewegung Bewegung, und es geht nicht um die Leiche, es geht um das Leben, es geht um die Hand, die sich bewegt. Die Anatomie des Lebendigen. Diese Art zu schauen, über das Offensichtliche hinauszugehen und sich auf die aufschlussreichen Details in einem Rahmen zu konzentrieren … das hat mich nicht mehr losgelassen, seit ich dieses Bild gesehen habe.
John Berger schreibt über dieses Gemälde, und er schreibt über seine Verbindung zu Che Guevaras Ermordungsfoto und die unheimlich zufällige Pose der beiden – wie auch auf Che’s Ermordungsfoto all diese Soldaten um seinen Leichnam herum stehen und in verschiedene Richtungen schauen, während ein Vorgesetzter auf den Leichnam zeigt. Und auch hier geht es nicht um den Tod, sondern um das Leben, das nach diesem Bild weitergehen wird. Über den Tod von Che hinaus. Über eine Revolution hinaus, die sie nun für gescheitert halten. Ich finde es wirklich faszinierend, diese beiden Bilder – das Gemälde und das Foto – als eine Möglichkeit zu betrachten, die Formbarkeit von Geschichte oder Erinnerung zu verstehen.
In diesen beiden Bildern geht es einerseits um den Tod, aber auch darum, wer schaut, wer zeigt, wer sich bewegt und wer sich nicht bewegen kann. Das war die Idee, die ich in den Wortbildern des Buches umsetzen wollte. Wer bewegt sich und wer kann sich nicht bewegen? Man denkt, es geht um das Sterben, aber in Wirklichkeit geht es um die Person, die noch lebt und die Macht hat. Es gibt verschiedene Ebenen und Schichten der Betrachtung. Wenn man dieses Wort-Bild hat, gibt es den Leser und dann gibt es auch die Geschichte, die wir durchlesen müssen, um zum Kern dessen zu gelangen, was auf diesem Foto wirklich gemacht oder aufgenommen wurde.
In "Der Schattenkönig" gibt es einige unglaubliche Momente des Widerstands gegen die Fotografie, in denen sich Blicke der Kamera entziehen oder sie anklagen, Beziehungen und Sinne den fotografischen Rahmen überschreiten oder bebende Körper die Möglichkeiten der Kameraaufnahme sprengen. Können Sie erläutern, warum Sie diese Störungen der Bilderzeugung beschrieben haben?
Es begann damit, dass ich mir diese Fotos anschaute und darauf achtete, was die Menschen tatsächlich tun, selbst wenn sie gerade stehen und in die Kamera schauen. Wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich keine stimmlosen Menschen gibt, sondern nur Menschen, die wir nicht hören können, dann besteht meine Aufgabe darin, zu beobachten, was sie mir sagen, was ich auf den ersten Blick nicht sehen konnte. Und was mir dabei auffiel, konnten Dinge sein wie eine Handbewegung, eine geballte Faust, nach innen gerollte Zehen, obwohl das nicht unbedingt eine natürliche Haltung ist, diese verschwommene Bewegung, der Blick weg, diese schnellen Gesten, die passieren, die Weigerung zu lächeln – all das waren kleine Akte des Trotzes. Sie sind gedämpft, aber sie waren da, wenn ich nur wüsste, wie man hinschaut, und das war ein Teil dessen, woran ich wirklich gearbeitet habe: Wie man sie genauer betrachtet, wie man ihnen zuhört. Es gibt immer, immer verräterische Hinweise in diesen Fotos. Ich wollte sie zum Leben erwecken, den Menschen den ihnen gebührenden Respekt für ihre Taten, ihre Tapferkeit, zurückgeben.
Wer sind die Bildgestalter:innen, die am meisten geprägt haben, wie Sie über Fotografie denken und wie Sie sie in Ihren Texten behandeln?
Diana Matar, zum Beispiel. Sie hat ein Buch mit dem Titel Evidence (Beweise) herausgebracht und ein weiteres in Vorbereitung, in dem sie sich mit dem unsichtbaren, aber präsenten Nachhall von Orten befasst, an denen staatlich sanktionierte Gewalt stattfand. Sie besucht diese Orte im Nachhinein und fotografiert sie. Dabei geht es ihr um die Frage: Was bleibt? Sie befasst sich mit der Auslöschung, aber auch mit den Erinnerungen, die an diesen Orten noch lebendig sind, an die verlorenen Leben nach einem Verschwinden oder nach einer Gräueltat. In Evidence reist sie nach Libyen und sucht die Orte auf, an denen Ghadaffi Menschen hinrichtete und die Menschen verschwanden. Anschließend fotografiert sie sie. Diese Bilder sind ein stummes Zeugnis für das, was jetzt fehlt, aber auch eine Bestätigung dafür, dass durch das Betrachten etwas ersetzt, bestätigt wird. Ich war in Brüssel, bevor diese ganze Sache mit dem Virus losging, und sie hatte eine Ausstellung in Verbindung mit einem neuen Buch, My America. Darin reiste sie quer durch die Vereinigten Staaten und fotografierte Orte polizeilicher Gewalt gegen Randgruppen der Gesellschaft. Die Wände der Galerie waren mit diesen Fotos gefüllt, mit den Namen der Toten, ihrem Alter, dem Todesdatum, den Orten… Das sind erstaunliche Mahnmale und Akte des Gedenkens. Ich betrachte ihre Arbeit als eine weitere Möglichkeit, über die Macht der Fotografie nachzudenken, aber auch über die Notwendigkeit des Erinnerns, selbst wenn es keine sichtbaren Spuren von dem gibt, was einmal da war.
In diesem Sinne bin ich der Arbeit eines argentinischen Fotografen namens Gustavo Germano verpflichtet. Als ich seine Fotos zum ersten Mal sah, blieben sie mir im Gedächtnis haften. Er arbeitet mit Kindheitsfotos von Menschen, die während der Kriege in Argentinien verschwunden waren. Auf einem Foto rennen zum Beispiel zwei Brüder einen Hügel hinunter, sie sind jung, vielleicht 10 Jahre alt. Einer von ihnen wurde schließlich, Jahre später, von den Militärs „verschwunden“. Germano fotografiert den überlebenden Bruder auf demselben Hügel und nimmt denselben Lauf auf und fügt diese Fotos dann zusammen. Man sieht sehr deutlich die Abwesenheit des anderen Geschwisters, die Abwesenheit so vieler Erinnerungen, die ein Leben ausmachen.
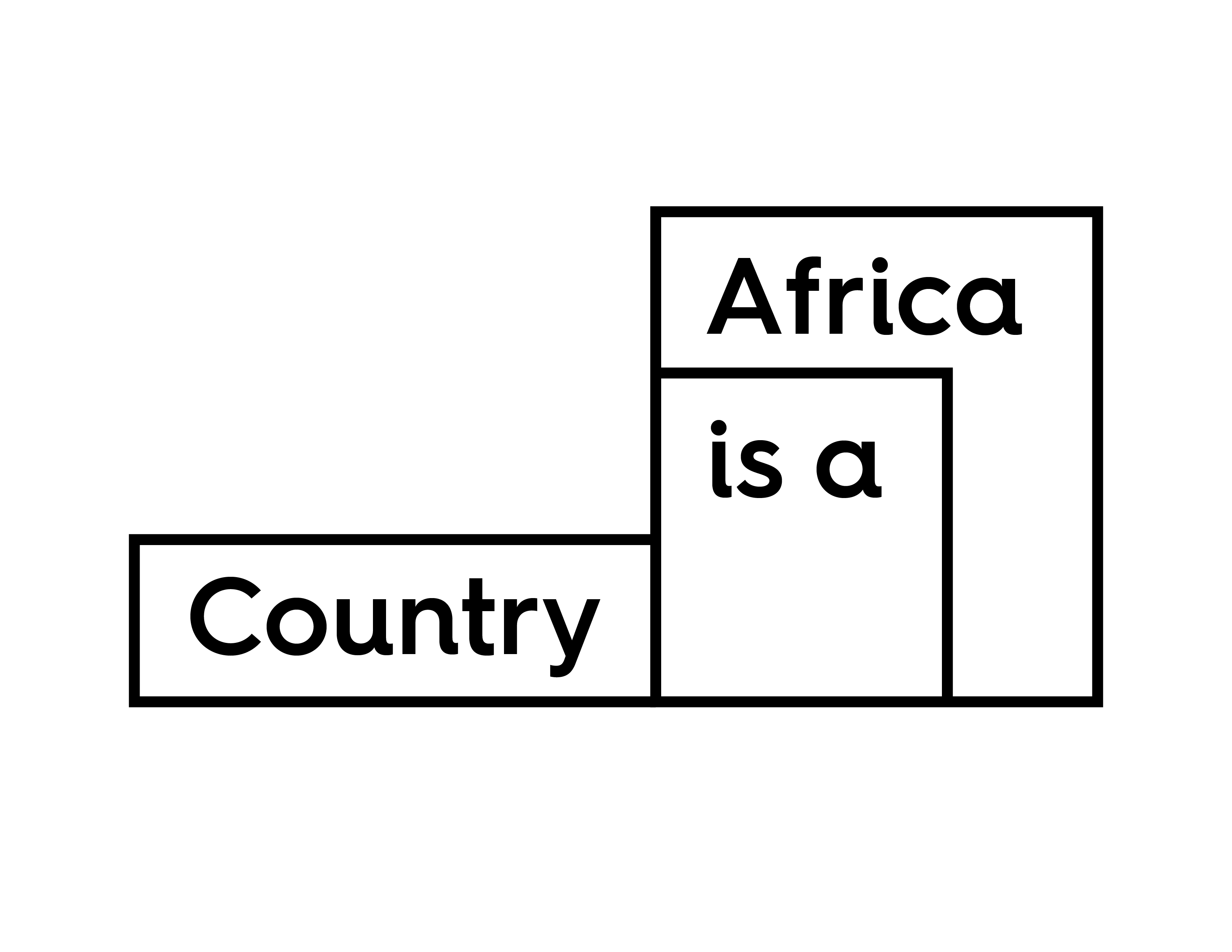
Confronting the weapon of photography
Und à propos Verschwinden: Es gibt einen wunderbaren chinesischen Fotografen namens Zhang Dali, der ein Fotobuch mit dem Titel A Second History veröffentlicht hat. Er befasst sich mit den Propagandafotos, die während der Mao-Tse-Tung-Ära in den Nachrichten abgedruckt wurden. Er untersucht die Manipulation von Fotos als eine Möglichkeit, die Geschichte und das kollektive Gedächtnis zu revidieren. Er zeigt, was in einer Zeitung gedruckt wurde und was tatsächlich das echte Foto war. Es ist faszinierend, wie Menschen, die bei Mao Tse Tung in Ungnade gefallen waren, aus den Bildern gelöscht wurden, und wie bei Menschenmengen, die zu klein waren und kein positives Licht auf ihn warfen, welche hinzugefügt wurden. Die Leute wurden umplatziert, umgestellt oder einfach ausradiert. Wenn man das sieht, wird man daran erinnert, wie flexibel die Wahrheit ist, wie zerbrechlich Geschichte, Erinnerung, kollektives Gedächtnis und Fakten sind. Wenn man sie nicht sehen kann, woher weiß man dann, dass sie tatsächlich existieren? Das ist eine Frage, über die ich in meinem Buch nachgedacht habe.
Und natürlich die Arbeit jener Fotograf:innen aus Afrika, die die postkoloniale Ära fotografiert haben, als verschiedene Teile Afrikas den westlichen Mächten im Grunde die Stirn boten! Malick Sidibé ist der bekannteste von ihnen, aber es gibt auch Jean Depara und so viele andere. Das Leben, das auf diesen Fotos zu sehen ist, finde ich wirklich spannend und inspirierend. Aida Muluneh, Nader Adem, Malin Fezehai, Martha Tadesse – Fotograf:innen aus Äthiopien und Eritrea – leisten unglaubliche, innovative und sensible Arbeit, aber es gibt noch so viele andere, die im Kommen sind. Sie haben die Kameras in der Hand, sie brauchen nur noch die Aufträge. Sie müssen vertreten werden und die Agenturen dazu bringen, sie anzurufen und zu sagen: „Ihr seid schon da, könnt ihr die Arbeit machen?“ Mulugeta Ayene, ein Äthiopier, hat gerade den World Press Photo-Wettbewerb 2020 gewonnen. Seine Fotos von dem Boeing-Absturz in Äthiopien sind sowohl episch als auch intim. Es ist ein Beweis dafür, was passiert, wenn der Fotograf die Kultur kennt, weiß, wie er sehen muss, und sich selbst in jedem Bild sieht. Es ist schön zu sehen, dass einige dieser Fotograf:innen Anerkennung finden, aber es muss noch mehr passieren.
Seit einiger Zeit haben Sie auf Instagram Archivfotos gepostet, die mit Ihren Recherchen für "Der Schattenkönig" in Verbindung stehen. Diese Sammlung bildet nun die Grundlage für ein digitales Fotoarchiv namens Projekt 3541, das als "Akt der Rückgewinnung" beschrieben wird, da es eine intime Zusammenstellung von Bildern im Zusammenhang mit der italienischen Invasion in Äthiopien von 1935-41 enthält. Wie stellen Sie sich die Auswirkungen und das Wachstum dieses Projekts vor?
Dieses Projekt ist ein gemeinschaftlicher Versuch, über einen Moment der Weltgeschichte zu sprechen und ihn zu verstehen. Diese Geschichte ist nicht nur äthiopisch, sie ist nicht nur ostafrikanisch. Es geht um Italiener:innen, um Brit:innen, um Menschen, die Teil der britischen Kolonialmacht waren, aus Indien und anderen Ländern, die sich an ihre Familienmitglieder erinnern, die nach Äthiopien gingen. Ich bin auf der Suche nach einigen dieser Fotos. Ich möchte, dass die Website eine Drehscheibe für diese Geschichte ist – für Geschichten. Ich bin mir bewusst, dass die meisten Ostafrikaner:innen keinen Zugang zu Kameras hatten und dass die Fotos, die sie vielleicht aus dieser Zeit hatten, von einem Italiener gemacht worden sein könnten. Ich habe auch eine Seite mit dem Titel „Erinnerungen ohne Gesichter“ eingerichtet, auf der ich die Leute auffordere, ihre Erinnerungen beizusteuern. Die Inspiration für diese Seite kam von jemandem, der zu mir sagte: „Mein Großonkel wurde in dieses Gefängnis gebracht, und er wurde zuletzt hier gesehen. Es gibt kein Foto, aber wie kann ich mehr herausfinden?“ Ein Italiener sagte: „Ich weiß, dass mein Großvater ein Kind von einer äthiopischen Frau hatte, vielleicht können Sie mir helfen, diese Person zu finden.“ Und ich weiß, dass es Geschichten gibt, bei denen es nicht um die Suche geht, sondern um die Anerkennung, die Rückforderung, und das kann auch ohne ein Foto geschehen. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, denn dieses Buch, Der Schattenkönig, hat mein Leben auf eine Weise verändert, wie es das erste Buch nicht getan hat. Dieses Buch hat mich in eine andere Kultur, eine andere Sprache, aber auch in verschiedene Aspekte meiner eigenen Geschichte eingeführt. Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist, das Buch ist fertig, aber die Sache ist noch nicht abgeschlossen, und ich denke, die Fotografien sind das Mittel, um Dinge voranzubringen.
Zachary Rosen ist Mitglied des Redaktionsausschusses von Africa is a Country.
Bild im Header: Ceilings, © Ritesh Uttamchandani

Amapiano Boom
Amapiano ist der momentan heißeste musikalische Exportschlager aus Südafrika
Dahomey von Mati Diop gewinnt Goldenen Bären
„Der vermessene Mensch“ ist der erste deutsche Kinofilm, der sich mit dem Völkermord an den Ovaherero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika beschäftigt. Kann der Film was?

Spotify in Afrika: Teil 2
Warum die Expansion von Musikstreamingdiensten nach Afrika eine Herausforderung ist. Von Marcel Sturm