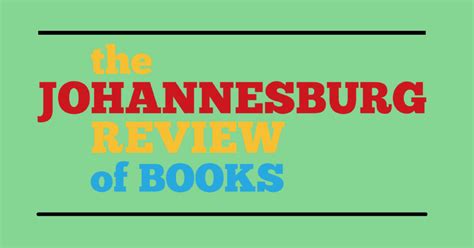zum Thema rassistische Gewalt
Der Roman Sie wäre König der liberianisch-amerikanischen Autorin Wayétu Moore, der im Herbst 2021 im akono Verlag erschienen ist, stand bereits mehrfach in der Kritik, weil darin einige Male das N-Wort ausgeschrieben wird. Dazu möchten wir im Folgenden gern Stellung nehmen und Übersetzer:innen, Betroffene und andere Interessierte zu einer offenen und respektvollen Debatte einladen, die Nuanciertheit, analytische Schärfe und best-practice Ideen zum Ziel hat.
Ja! zu rassismuskritischer Sprache
Vorweg sei gesagt, dass wir zu keinem Zeitpunkt hinter die Anliegen rassismuskritischer Sprache zurückfallen wollten. Das N-Wort ist ein rassistisches Schimpfwort, das aus der Rassentheorie und vor dem Hintergrund der weißen kolonialen Unterwerfung zu einer Fremdbezeichnung mit abwertendem Charakter wurde, das unendlich viel Leid und Gewalt, Dehumanisierung und Herabwürdigung in sich trägt. Dieses Wort nicht mehr zu reproduzieren, ist geboten, weil es für Schwarze Menschen eine retraumatisierende Beleidigung darstellt und auch, weil dessen Aussprache durch weiße Menschen diesen innerhalb einer rassistischen Gesellschaftsordnung erneut privilegierte Autorität verschafft und somit koloniale Herrschaftsverhältnisse aufrecht erhält.
Eine Geschichte des Widerstands
Der Roman Sie wäre König spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und thematisiert den Widerstand gegen koloniale Gewalt und Versklavung in Afrika und in der afrikanischen Diaspora anhand der Entstehungsgeschichte Liberias. Liberia wurde als neue Heimat für befreite ehemals versklavte Afroamerikaner:innen etabliert, nachdem die American Colonization Society 1816 vom amerikanischen Kongress ein Rückführungsmandat erhalten hatte. Die Schriftstellerin Wayétu Moore erklärt den Hintergrund ihres Romans wie folgt:
Liberia ist eine Geschichte des Widerstandes. Als ich begann, Sie wäre König zu schreiben, habe ich ziemlich intensiv verschiedene Widerstandsbewegungen und Aufstandsbewegungen in der afrikanischen Diaspora von Menschen afrikanischer Abstammung recherchiert. Das war gewaltig – da gab es Gaspar Yanga in Mexico und José Antonio Aponte in Kuba, wie auch in Haiti und Liberia und Nat Turner, und ich wollte, dass die Geschichte in ihrem Kern von Widerstand handelt.
Wayétu Moore im Interview mit akono
In „Sie wäre König“ treffen drei Figuren, die aus Lai in Westafrika, von einer Plantage in Virginia und aus den Blauen Bergen in Jamaika kommen, in den 1830er Jahren im Gebiet des späteren Liberia aufeinander. Alle drei Figuren haben besondere Kräfte, die in Bezug stehen zu der Gewalt, die im Laufe der Weltgeschichte Schwarzen Körpern angetan wurde, und vereinen sich zum Kampf gegen Unterdrückung, Versklavung und koloniale Fremdherrschaft. Die drei Charaktere verkörpern die diverse kulturelle Zusammensetzung Liberias, das aus indigenen Gruppen, Afroamerikaner:innen und aus der Karibik, vor allem aus Barbados, stammenden Gruppen besteht.

Historische Authentizität und Unverfälschtheit
Alle drei Charaktere und ihre zugehörigen Communities sind im Laufe der Geschichte enormer Gewalt ausgesetzt und werden im englischen Original einige Male mit beiden ausgeschriebenen N-Worten bezeichnet. Wir haben uns bei der Übersetzung entschieden, die Stimme der Schwarzen Autorin so unverfälscht wie möglich zu belassen und das Ausmaß der Gewalt in seiner Drastik so weit darzustellen, wie sie es gewollt hat. Insgesamt ist das deutsche N-Wort im Roman 24 mal ausgeschrieben. Wegen des Risikos, dass bei Betroffenen Ängste, Flashbacks oder andere psychische Reaktionen ausgelöst werden, enthält der Roman nun eine Triggerwarnung auf dem Cover und einen Übersetzungskommentar. Außerdem führt ein QR-Code im Buch zu dieser Debatte.
Einladung zur sachlichen Debatte
Nach zahlreichen Gesprächen mit Übersetzer:innen, Autor:innen und von rassistischer Gewalt Betroffenen, die jeweils aus sehr unterschiedlichen Perspektiven sprachen, ist uns bewusst geworden, dass es zum Umgang mit der Übersetzung des N-Wortes bisher keine bestmögliche einheitliche Herangehensweise gibt.
Daher möchten wir alle, die Interesse und Kapazitäten haben, sich an dieser Diskussion zu beteiligen, einladen, ihre Perspektiven und Ideen zu teilen.
* Spielt es bspw. eine Rolle, das der Text im Jahr 2018 bewusst mit dieser Terminologie veröffentlicht wurde und es sich nicht um eine Neuübersetzung eines alten Textes handelt?
* Welche kreativen Ideen gibt es, das N-Wort zu dekonstruieren?
* Wie steht ihr zu Euphemismen wie etwa „Schokosoldat“ (für Senegalschützen, so übersetzt in David Diop: Nachts ist unser Blut schwarz von Andreas Jandl)
* Was für eine Bedeutungsverschiebung findet statt, wenn der Text einer Schwarzen Person von einer weißen Person übersetzt wird in Bezug auf diese Thematik?
Wir bitten darum, das N-Wort in der Debatte nicht auszuschreiben.